       |
|
|
|
3.
Raumwahrnehmung und Praktisches Denken
|
|
|
|
Viele der
vermeintlichen Fotobeweise
ergeben sich aus Nichtbeachtung oder Fehleinschätzung
der dreidimensionalen Wirklichkeit. In diesem Teil werden wir untersuchen,
wie es um Gernot Geises 3D-Wahrnehmung bestellt ist. Weiterhin soll analysiert werden, wie er praktische
Probleme und Berechnungen angeht.
|
|
|
|
3.1 Schattenwürfe
in verschiedene Richtungen
|
|
3.2 Wer hat Aldrin fotografiert?
|
|
3.3 Die Aufstellung des
Laserreflektors
|
|
3.4 Die Entfernung Erde-Mond
|
|
3.5 LM und CSM im Mondorbit
|
|
3.6 Gernot Geise berechnet
Umlaufbahnen
|
|
3.7 Die Größe der Erde in den
Apollofotos
|
|
3.8 Die Höhe der Erde über dem
Mondhorizont
|
|
3.9 Die Flugfähigkeit der
Mondfähre
|
|
3.10 Die Flugfähigkeit der
Mondfähre mit "angeflanschtem" Rover
|
|
3.11 Fazit
|
|
3.12 Anhang
|
|
|
|
3.1 Schattenwürfe
in verschiedene Richtungen
|
|
|
 Wie
ist es möglich, dass auf verschiedenen Bildern von den Astronauten
bei ihren Mondaktivitäten mehrere Schattenwürfe in
verschiedene Richtungen erkennbar sind? In einer Halle mit
verschiedenen Deckenscheinwerfern sind solche Bilder möglich, unter
Sonnenlicht ausnahmslos niemals. Schatten fallen immer in die
selbe Richtung, wenn nur eine einzige Lichtquelle vorhanden ist, die
weit genug entfernt ist, wie die Sonne. Sie können nicht nach links
und rechts fallen, und wenn die Gegend noch so hügelig ist. ["Die
dunkle Seite von Apollo" S.95-107] Wie
ist es möglich, dass auf verschiedenen Bildern von den Astronauten
bei ihren Mondaktivitäten mehrere Schattenwürfe in
verschiedene Richtungen erkennbar sind? In einer Halle mit
verschiedenen Deckenscheinwerfern sind solche Bilder möglich, unter
Sonnenlicht ausnahmslos niemals. Schatten fallen immer in die
selbe Richtung, wenn nur eine einzige Lichtquelle vorhanden ist, die
weit genug entfernt ist, wie die Sonne. Sie können nicht nach links
und rechts fallen, und wenn die Gegend noch so hügelig ist. ["Die
dunkle Seite von Apollo" S.95-107]
|
|
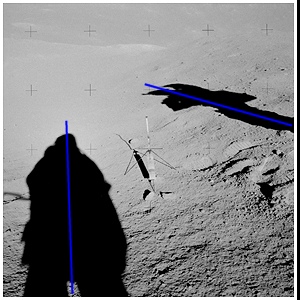 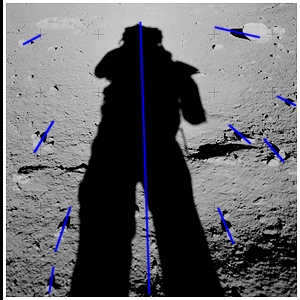 |
|
|
Dieses Argument ist nicht neu und wurde auch
nicht zum ersten mal von Gernot Geise vorgebracht. Alle
Moonhoax-Autoren haben nichtparallele Schatten in ihrem
Verkaufsprogramm. Doch es ist bezeichnend, dass ihnen diese ausschließlich in
Mondfotos
auffallen, nicht jedoch in Fotos, die auf der Erde gemacht wurden. Für die extrem divergierenden Schatten in
Apollo-Trainingsfotos (die sie ja auch kennen und abdrucken) sind sie völlig
blind. Zum Beispiel zeigt AP17-KSC-72P-438
genau das, was
angeblich unmöglich ist: Nichtparallele Schatten im Sonnenlicht!
|
|
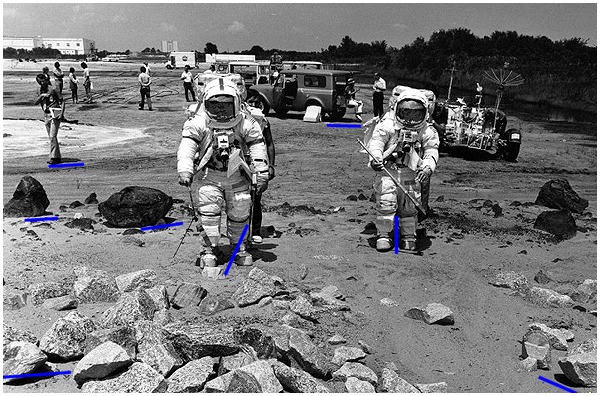 |
|
|
Dieses eine Bild reicht, um die gesamte Argumentation
der Autoren als Unsinn zu entlarven!
|
|
Wer mit offenen Augen durch die Welt geht (was Gernot
Geise lautstark für sich beansprucht) weiß, dass parallele
Linien selten
parallel gesehen werden. Das gilt auch für Schatten. Beispiele: in
der Stadt / im
Wald / Apollo15
Training
/ Apollo16
Training. Selbst in Fotos vom Mars sind die Schatten nicht parallel
(Viking
01 / Viking 02
/ Opportunity).
|
|
|
|
In Die Schatten von Apollo (2003)
S.142 beschreibt Geise seinen Versuch dem Schattenrätsel auf
die Spur zu kommen. Er geht hinaus in die Sonne, schießt ein Foto und
macht sich seine Gedanken:
|
|
|
|
 Verschiedene
Schattenobjekte (von links): Ein Baum, der Autor, ein in die
Erde gestecktes Brett, eine Baumscheibe, ein Busch und ganz
rechts die Kante eines Hausschattens. Alle Schatten streben erst in
der Ferne zueinander, wobei hier eine gewisse Verzerrung durch das
Kameraobjektiv hinzu kommt. Rechtwinklig verläuft keiner der Schatten. Verschiedene
Schattenobjekte (von links): Ein Baum, der Autor, ein in die
Erde gestecktes Brett, eine Baumscheibe, ein Busch und ganz
rechts die Kante eines Hausschattens. Alle Schatten streben erst in
der Ferne zueinander, wobei hier eine gewisse Verzerrung durch das
Kameraobjektiv hinzu kommt. Rechtwinklig verläuft keiner der Schatten.
|
|
|
 |
|
|
Das Experiment ist gelungen, die Schlussfolgerungen
aber falsch! Ohne es zu
bemerken, zerlegt Geise hier seine eigenen Behauptungen. Die Schatten
sollen erst in der Ferne zueinander streben? Keiner der
Schatten soll rechtwinklig zu einem anderen sein? Unsinn! Die Schatten links und rechts bilden sogar
einen Winkel der größer ist als 90°. Wenn wir in diesem Bild die entsprechenden Projektionslinien
einzeichnen (unten), wird erkennbar, dass alle Schatten auf einen gemeinsamen
Fluchtpunkt zulaufen. Dort wäre bei völlig flacher Ebene und freier
Sicht der Horizont. Verzerrungen durch das Kameraobjektiv, wie Geise vermutet, spielen
dabei praktisch keine Rolle.
Auch das menschliche Auge sieht die Schatten ähnlich. Es ist
nichts anderes als eine optische Täuschung, die jeder (?) unter der
Bezeichnung Raumperspektive
kennt.
|
|
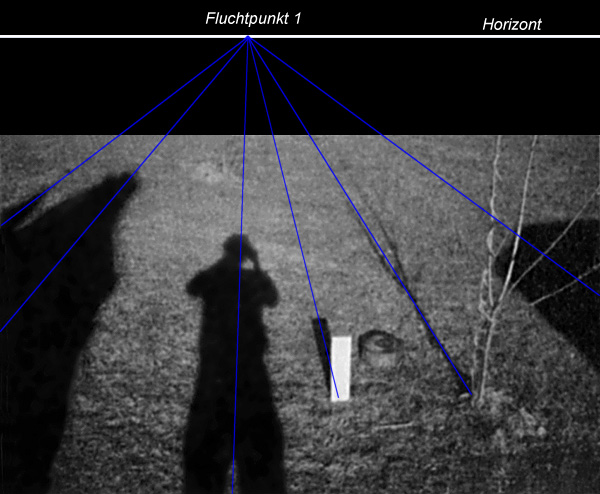 |
|
|
Die einfache Tatsache, dass Objekte mit zunehmender
Entfernung kleiner erscheinen, ist
Geise und den anderen Autoren wohl noch bewusst. Dass sich daraus aber
zwangsläufig ergibt,
dass parallele Linien nicht mehr parallel gesehen werden, haben die
meisten bis
heute nicht begriffen.
|
|
|
|
Schon die Römer haben in Wandgemälden die
Raumperspektive berücksichtigt. Damals noch eher intuitiv, denn die
genauen geometrischen Zusammenhänge verstanden sie noch nicht. Seit der
Renaissance (beginnend mit Brunelleschi
[0]),
also seit etwa 600 Jahren, sind die Gesetze der Zentral- bzw.
Fluchtpunktperspektive bekannt, und können auch mathematisch exakt
beschrieben werden. So läßt sich mit Fug und Recht behaupten: Das
Wissen um die Perspektive gehört zur Allgemeinbildung! Die
zeichnerischen Grundlagen sind nicht schwer zu verstehen, sie lassen
sich ohne weiteres einem 10jährigem Kind vermitteln. Weblinks: Raumwahrnehmung
/
Perspektive
/
Fluchtpunktperspektive / Stürzende Linien
/ Radiant
/ Schattenperspektive
|
|
|
|
Eisenbahnschienen eignen sich gut um die räumliche
Perspektive zu analysieren. Diese sind natürlich immer parallel
zueinander [1] und von oben (Schienen
01) sowie 90° von der Seite betrachtet (Schienen
02) sehen wir sie auch parallel. Stehen wir aber auf dem Bahngleis,
und schauen entlang der Strecke, dann scheinen sie auf einen Fluchtpunkt
am Horizont zuzulaufen (Schienen
03). Unser Gehirn interpretiert die Schienen weiterhin als parallel,
verbindet dies aber mit einem räumlichen Eindruck. Verlegen wir den
Beobachtungspunkt (ob Augen oder Kamera) weiter nach unten, dann wird
der Winkel zunehmend flacher, bis die Linien praktisch mit dem Horizont
zusammen fallen (fast in Schienen
04). Der theoretische Grenzwinkel der Perspektive beträgt also
180°. Nicht anders verhält es sich mit Schatten im Sonnenlicht. Wenn
wir annehmen, die Sonne steht in unserem letzten Beispiel über dem
Fluchtpunkt und Gegenstände stehen auf den Schienen, dann fallen die
Schatten genau auf die Schienenoberflächen (Schienen
05). Die Schatten verlaufen wie die Schienen absolut parallel
zueinander - in der 3D-Realität, nicht im 2D-Foto!
|
|
|
|
Es wird oft behauptet, dass extreme Weitwinkel starke
Verzerrungen erzeugen und mit für die nichtparallelen Schatten
verantwortlich sind. Das ist aber nicht so! Bei einem Weitwinkel
fallen Perspektivverzerrungen nur stärker auf, weil mehr Objekte im
Bild sind. Vom gleichen Standpunkt und in die gleiche Richtung
fotografiert, erhält man mit einem Tele ein Bild, was geometrisch exakt
der Bildmitte der Weitwinkelaufnahme entspricht (Schienen
06). Das läßt sich mit einer Kamera mit Zoomobjektiv auf einem
Stativ leicht nachvollziehen. Nur eine Standpunktänderung und/oder andere
Blickrichtung ergibt eine andere Perspektive!
|
|
|
|
Die Perspektive hat in der Regel den
größten Einfluss auf die Wahrnehmung der Schattenrichtungen. Es gibt aber noch
weitere
Gründe, warum Sonnenschatten nicht parallel verlaufen, bzw. nicht parallel erscheinen. Insgesamt sind
es:
|
|
|
|
1. |
Perspektivische Verzerrung
|
|
|
Wie gezeigt, können parallele Schatten in Fotos
um bis zu 180°
differieren.
|
|
|
|
|
2. |
Panorama-Aufnahmen als Sonderfall der Perspektive
|
|
|
Parallele Schatten laufen bis zu 360°
um (Beispiel
01 / Beispiel
02 / Beispiel
Apollo17).
|
|
|
|
|
3. |
Unebener Boden, also geneigte oder wellige
Schatten-Projektionsflächen
|
|
|
Wenn das Sonnenlicht direkt von der Seite kommt
(Aufnahmewinkel 90° zur Sonne), sind Schatten
auf einer ebenen Fläche immer parallel (Beispiel
01). Auf unebenen Flächen können Schatten dagegen
stark divergieren (Beispiel
02 / Beispiel
03). So kann etwa ein gerader Flaggenstab einen sehr welligen
Schatten werfen (Beispiel
04). Die Mondoberfläche ist keine vollkommen flache Ebene.
Allein aus diesem Grund sind parallele Schatten in den Apollofotos
eher die Ausnahme.
|
|
|
|
|
4. |
Form und Stellung der schattenwerfenden Objekte
|
|
|
Schattenrichtungen
bei überhängenden Steinen / 20744: Stein oben rechts
ist deutlich sichtbar überhängend / 22162:
besonders Stein 1 in Bildmitte / Apollo17-Trainingsfoto
(big):
Die Steine links und rechts im Vordergrund. |
|
|
|
|
5. |
Schattenverdeckung |
|
|
Zum Beispiel wenn ein flacher Hügel vor einem
Schatten scheinbar deren Richtung verändert.
|
|
|
|
|
6. |
Weitere Optische Täuschungen
|
|
|
Fehldeutungen, Erwartungshaltung usw.
|
|
|
|
|
7. |
Objektivverzeichnung
|
|
|
Bei normal korrigierten Fotoobjektiven ist dieser
Einfluss sehr gering! Verzeichnungen unter 0,5% sind nur bei sehr
kritischen Motiven (z.B. plan aufgenommene Gitterstruktur), und auch nur an den
Bildrändern sichtbar. Beispiel: Voigtländer
2/40mm mit 0,65% tonnenförmiger Verzeichnung. Das auf dem Mond verwendete ZEISS Biogon
5,6/60mm
hat eine extrem geringe Verzeichnung von <0,002% (siehe Datenblatt
/ S.2 unten rechts).
|
|
|
|
|
Alle diese Einflüsse im Einzelnen zu analysieren, würde
hier zu weit gehen. Der Verweis auf die Beispiele sollte genügen. Alle
Ursachen können sich addieren oder auch gegenseitig aufheben. So sind
selbst bei direkt nebeneinander liegenden Objekten stark
unterschiedliche Schattenrichtungen möglich, wie bei as17-145-22162
(big). Die Moonhoax-Autoren haben nicht eine
der natürlichen
Ursachen ernsthaft in Erwägung gezogen. Konventionelle Deutungen
verstehen sie nicht und lehnen
sie als nichtzutreffend ab. Sie stürzen sich dagegen auf eine zusätzliche
Beleuchtung, die besser in ihr Fälschungskonzept passt. So auch Gernot
Geise.
|
|
|
|
 Bei
allen Überlegungen, ob und wie, warum oder warum nicht, ob ein oder
mehrere Schatten vorhanden sein müssten, lassen sich Kritiker wie Befürworter
(und bisher auch ich) allesamt von laienhaften
Beleuchtungs-Vorstellungen leiten, die mit der Praxis herzlich wenig
gemeinsam haben, wie mich ein Kameramann während eines TV-Interviews
aufklärte. Selbstverständlich können auf der Mondszene mehrere
Scheinwerfer im Einsatz gewesen sein, ohne dass mehrere Schatten
entstehen müssen. Wenn die Scheinwerfer richtig ausgerichtet sind, wird
ein schwächerer Schatten schlichtweg durch einen gerichteten Spot überstrahlt,
so dass nur der stärkere Schatten erhalten bleibt. Das ist eine gängige
Technik, die im Fernsehen täglich angewendet wird! Dort eliminiert man
den Hauptschatten dann durch seitliches weiches Licht. Es stimmt also:
Die in einem unnatürlichen Winkel zueinander verlaufenden Schattenwürfe
entstanden nicht durch irgendwelche obskuren Gelände-Verformungen, die
auf den Bildern nicht erkennbar sind, sondern durch zielgerichtete
Spot-Scheinwerfer. ["Die
Schatten von Apollo" S.143/144] [Weblink] Bei
allen Überlegungen, ob und wie, warum oder warum nicht, ob ein oder
mehrere Schatten vorhanden sein müssten, lassen sich Kritiker wie Befürworter
(und bisher auch ich) allesamt von laienhaften
Beleuchtungs-Vorstellungen leiten, die mit der Praxis herzlich wenig
gemeinsam haben, wie mich ein Kameramann während eines TV-Interviews
aufklärte. Selbstverständlich können auf der Mondszene mehrere
Scheinwerfer im Einsatz gewesen sein, ohne dass mehrere Schatten
entstehen müssen. Wenn die Scheinwerfer richtig ausgerichtet sind, wird
ein schwächerer Schatten schlichtweg durch einen gerichteten Spot überstrahlt,
so dass nur der stärkere Schatten erhalten bleibt. Das ist eine gängige
Technik, die im Fernsehen täglich angewendet wird! Dort eliminiert man
den Hauptschatten dann durch seitliches weiches Licht. Es stimmt also:
Die in einem unnatürlichen Winkel zueinander verlaufenden Schattenwürfe
entstanden nicht durch irgendwelche obskuren Gelände-Verformungen, die
auf den Bildern nicht erkennbar sind, sondern durch zielgerichtete
Spot-Scheinwerfer. ["Die
Schatten von Apollo" S.143/144] [Weblink]
|
|
|
|
Ob Geise wirklich mit einem Kameramann gesprochen,
oder er diesen nur falsch verstanden hat, sei dahingestellt. Es
scheint hier aber auch nicht ganz klar zu sein, ob die Eigenschatten
der Objekte oder ihre Schlagschatten gemeint sind (Beispiel). Das
beschriebene Vorgehen bezieht sich vemutlich nur
auf die Eigenschatten und mag daher für TV- und Filmproduktionen
akzeptabel
sein, wo es eher auf Stimmungen als auf Realismus
ankommt. Für eine Fälschung der Mondlandung ist es nicht anwendbar, schon
allein deswegen, weil die Schlagschatten extrem dunkel sein müssen.
|
|
|
|
Werden zwei Objekte mit zwei Spotlampen angestrahlt,
dann wirft jedes Objekt entweder zwei Schatten, wenn sich die Lichtkegel
überkreuzen, oder es gibt getrennte Schatten, mit sichtbar abgegrenzten
Lichtkegeln. Man kann eine Fläche
nicht mit mehreren Scheinwerfern ausleuchten, ohne auffallende Lichtkegel,
Mehrfachschatten und/oder Halbschatten zu erzeugen. Das ist eine
triviale Erkenntnis. In den Apollofotos sehen wir weder abgegrenzte Lichtkegel, noch
überstrahlte Schatten und auch keine Mehrfachschatten. Beispiel 01 /
Beispiel
02 / Beispiel 03
|
|
Die Idee mit den Spotscheinwerfern ist aber noch aus anderen
Gründen völlig abwegig. Wenn man sich die
Apollo-Fotos in höherer Auflösung anschaut, läßt sich feststellen,
dass fast jeder einzelne
Stein eine eigene Schattenrichtung hat (Beispiel
22162 / big).
Die praktische Konsequenz daraus: Jedes kleine Steinchen müsste von einem
eigenen Spot beleuchtet sein. Das ist absurd, aber für Gernot Geise offenbar
kein Grund seine Schlussfolgerungen zu überdenken.
|
|
|
|
Nehmen wir einmal kurz an, das Szenario mit den Spotlampen
wäre tatsächlich praktikabel. Dann bleibt die Frage nach dem warum:
Denn wenn Sonnenschatten in Fotos tatsächlich immer parallel sein müssten,
sollte man dann nicht annehmen, dass die "Apollo-Fälscher"
bestrebt waren, diese auch so erscheinen zu lassen? Warum also
haben sie die Spotstrahler nicht so ausgericht, dass die Schatten in den
Apollo-Fotos parallel sind? Soll die NASA den
extremen Aufwand (mit jeweils Hunderten von Spots pro Bild) etwa nur betrieben haben, damit es
falsch aussieht? Und wenn diese Beleuchtungsmethode für die Apollofotos
praktikabel gewesen wäre (was nicht
der Fall ist), wie soll das bei den TV-Aufnahmen funktionieren, mit bis zu 2,5h
ununterbrochenen 360°-Schwenks?
|
|
Die Moonhoax-Autoren treiben die Pferde mit
aller Kraft in die falsche Richtung und entlarven sich damit selbst, nicht die NASA. Wer die Sonne realistisch
vortäuschen möchte, ist immer gezwungen einen einzigen extrem starken
und zugleich geometrisch kleinen Scheinwerfer
zu verwenden. Alle anderen Beleuchtungsvarianten scheitern in der praktischen Anwendung und
werden immer sichtbar sein! Siehe auch Clavius-Wisnewski
2.4
|
|
|
Wenn man alles zusammenkratzt, was Gernot Geise in Büchern und Artikeln
zu den Apolloschatten geschrieben hat, kommt man auf gut 20-30
Seiten. Der alles entscheidende Begriff "Perspektive" kommt darin nicht ein einziges mal vor. Wenn
er wirklich "Techniker des grafischen Gewerbes" wäre, so müssten
ihm die Grundlagen der Fluchtpunktperspektive
geläufig sein, denn die gehört
seit jeher zum Ausbildungslehrplan. Er kennt sich also offenbar nicht mal in seinem eigenen
Fachgebiet aus. Erstaunlich ist auch, dass er extrem divergierende Schatten
nur in Apollofotos, nicht aber in eigenen Fotos sieht (Beispiel Ägypten:
Hatschepsut-078).
|
|
In dieser Beziehung ist auch erwähnenswert, dass sich
Gernot Geise in den
1990er Jahren, unter dem Pseudonym Gustav Eichl, als Landschaftsmaler betätigt
hat. In mindestens einem Aquarellbild (Schwabsoien
149)
hat er "nichtparallele Sonnenschatten" gemalt. Konfrontiert mit diesem
krassen Widerspruch, hat er, anstatt seinen Fehler einzugestehen, das Bild still und heimlich aus seiner
Online-Galerie [2] entfernt. Eine der üblichen Vertuschungsaktionen, die
so typisch sind für Pseudowissenschaftler. Seine Leser erfahren von alldem natürlich
nichts.
|
|
|
|
Die Autoren brüten seit
Jahren über die Schatten (Geise mind. seit 1999), ein Erkenntnisfortschritt ist nicht
auszumachen. Sie sind allesamt erstarrt in einer immergleichen
Argumentationsfolge:
|
|
|
|
Die Strahlen der Sonne sind immer parallel →
parallele Sonnenstrahlen führen immer zu parallelen Schatten →
in den Apollofotos sind die Schatten nicht parallel → daher sind
die Apollofotos nicht im Sonnenlicht entstanden → auf dem Mond
gibt es nur Sonnenlicht → also sind die Fotos nicht auf dem Mond
gemacht worden → folglich waren die Astronauten nicht auf dem
Mond → Beweis erbracht: Apollo ist eine Fälschung!
|
|
|
|
Die Argumentation ist vom ersten bis zum letzten
Punkt fehlerhaft. Es macht jedoch wenig Sinn ihnen das zu erklären.
Das haben schon viele versucht. Eine gewisse intellektuelle Hürde können
oder wollen sie nicht überspringen. Eine Störung von außen - wie
diese Seite - bringt
sie allenfalls kurzzeitig ins Grübeln. Wenig später spulen sie wieder
ihre gewohnte Endlosschleife ab. So können wir auch in Geises
neuster
Veröffentlichung Auch
über den Weltraum wird gelogen (2006) keinerlei Besserung
feststellen. Er sollte sich mal Gedanken machen, was das über ihn selbst
aussagt ...
|
|
|
Update Mai 2007:
Überraschenderweise versucht Geise inzwischen den Eindruck zu erwecken,
er hätte das mit den Apollo-Schatten immer schon gewußt. In seiner Kritik zum
Apollo-Vortrag, von
Raumfahrtingenieur Rainer Kresken (23.03.2007 / Kötzting Bayern), schreibt er u.a.:
|
|
|
|
 Einen
ziemlich langen Teil seines Vortrages widmete Kresken den
Schattenlinien, um darzulegen, dass alles Unsinn ist, was diesbezüglich
von den „Verschwörungstheoretikern“ behauptet wird. Dazu zeigte er
mehrere Bilder, u. a. von Sportplatz-Linien, um darzulegen, dass
Schatten durchaus nicht immer parallel verlaufen müssen. Das hatte ich
zwar in „Die dunkle Seite von APOLLO“ auch schon dargelegt, was
Kresken jedoch nicht wusste, denn er schob mich in dieselbe Schublade,
in der sich schon andere „Verschwörungsgläubige“ befanden, die
jeden nichtparallelen Schatten bestreiten.
[Weblink] Einen
ziemlich langen Teil seines Vortrages widmete Kresken den
Schattenlinien, um darzulegen, dass alles Unsinn ist, was diesbezüglich
von den „Verschwörungstheoretikern“ behauptet wird. Dazu zeigte er
mehrere Bilder, u. a. von Sportplatz-Linien, um darzulegen, dass
Schatten durchaus nicht immer parallel verlaufen müssen. Das hatte ich
zwar in „Die dunkle Seite von APOLLO“ auch schon dargelegt, was
Kresken jedoch nicht wusste, denn er schob mich in dieselbe Schublade,
in der sich schon andere „Verschwörungsgläubige“ befanden, die
jeden nichtparallelen Schatten bestreiten.
[Weblink]
|
|
|
|
Das ist dreist gelogen, denn in seinem Buch Die
dunkle Seite von Apollo (2002) steht
nicht ein einziger Satz, der deutlich macht, dass er nichtparallele Schatten im Sonnenlicht
zuläßt. Doch der Sinneswandel (wenn es einer ist) muss sich schrittweise vollzogen haben.
Nach jahrelanger Totalverweigerung (mindestens von 1999-2002), deutet er
in seinem dritten Apollo-Buch Die Schatten von
Apollo (2003) an, dass er unebenen Boden als Einfluss auf den
Schattenverlauf für bedingt möglich hält. Nachlesen können wir dort
aber auch, dass Sonnenschatten im Winkel von 90° schlicht unmöglich
sind (siehe sein Experiment oben). Außer
Geises aktueller Aussage,
"er hätte das alles niemals behauptet", weist nichts darauf
hin, dass er seine Fehler erkannt, und die Schattenproblematik verstanden hat. Im Gegenteil:
Bisher hat er jede Gelegenheit genutzt, seine falsche Sicht der Dinge unmissverständlich
klarzumachen.
|
|
|
|
Geises Täuschungsmanöver läßt sich hier eindeutig belegen, da die entsprechenden Passagen
in den Büchern nachgelesen werden können. Auch seine
Online-Artikel sprechen eine deutliche Sprache, zumal diese inhaltlich
identisch sind mit den Buchkapiteln. Hier einige Beispiele:
|
|
|
|
War
überhaupt jemals ein Astronaut auf dem Mond? (1999) und Welcher
Astronaut war wirklich auf dem Mond? (2000): Wie
ist es möglich, dass auf verschiedenen Bildern mehrere Schattenwürfe
in verschiedene Richtungen erkennbar sind?
Sie
können nur entstehen, wenn mehrere Beleuchtungskörper verwendet
wurden, die voneinander entfernt positioniert aufgestellt waren.
|
|
Der
Mondlandungs-Betrug - Fragen und Antworten 1 (2001): Schatten
fallen IMMER in dieselbe Richtung (wenn nur eine einzige Lichtquelle
vorhanden ist, die weit genug entfernt ist, wie die Sonne). Sie können
nicht nach links und rechts fallen, und wenn die Gegend noch so hügelig
ist. Das kann man an einem Sonnentag selbst ausprobieren. Das kann auch
jeder Fotograf bestätigen.
Einzige Ausnahmen für verschiedene Richtungen können entstehen, wenn
sich die Beleuchtung in unmittelbarer Nähe hinter dem schattenwerfenden
Objekt befindet. Aber das ist bei der Sonne ja nicht der Fall. ... ... Die
Schattenrichtung MUSS immer dieselbe und parallel sein. ... ... Schatten
fallen immer parallel.
|
|
Die
APOLLO-Diskussion geht weiter (2001): Auf
vielen APOLLO-Fotos sind merkwürdige Schattenrichtungen zu sehen. Die
Schattenrichtungen verlaufen nicht parallel, wie es anzunehmen ist, wenn
nur die Sonne als einziger Beleuchtungskörper vorhanden ist. ... ...
Schatten in alle Richtungen. Wie soll das funktionieren, wenn die Sonne
der einzige Lichtkörper war? (APOLLO 17) ... ... Schatten
müssen immer parallel verlaufen, wenn sie durch die Sonne erzeugt
wurden. ... ... Aber Schatten, die auf demselben Bild nach links und
rechts zeigen, können so nur zustande kommen, wenn die Beleuchtung in
unmittelbarer Nähe steht, und nicht, wenn sie von der Sonne stammen.
Dann müssen sie zwangsläufig parallel verlaufen.
|
|
Apollo-Seite:
Unterschiedliche Schattenrichtungen (2004/05?): Die
Sonne als Beleuchtungskörper ist sehr weit entfernt. Deshalb müssen
Schatten immer mehr oder weniger (abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit)
parallel verlaufen. ... ... Die in einem unnatürlichen Winkel
zueinander verlaufenden Schattenwürfe entstanden also möglicherweise
nicht durch irgendwelche Gelände-Verformungen, die auf den Bildern
nicht erkennbar sind, sondern durch zielgerichtete Spot- Scheinwerfer.
|
|
In einer Email an Johannes Meinert (07.03):
Einwandfrei
erklären lassen sich die teils rechtwinkligen Schatten bisher nicht,
auch von mir nicht.
|
|
In einer Email an Susanne Walter (11.01.04): Fachleute
wissen halt, dass voneinander abweichende Schattenrichtungen nur
durch Spot-Scheinwerfer erzeugt werden können.
|
|
In einem Brief an Helmut Dette (28.03.06): Ihre
Ausführungen zu den Schattenrichtungen stimmen natürlich. - Sofern es
sich um gewisse Abweichungen von der Ideallinie handelt. Sie erklären
jedoch nicht die Schattenwürfe, die teilweise rechtwinklig zueinander
laufen.
|
|
|
|
Die immer gleichen Ansichten vertritt er auch in seinen
Apollo-Vorträgen. So etwa bei einem protokollierten Vortrag in Regen
(Bayern) [Weblink].
So hat er durchaus recht, wenn er schreibt: "Er
(Kresken) schob mich in dieselbe
Schublade, in der sich schon andere Verschwörungsgläubige
befanden".
Genau in diese Schublade gehört Gernot Geise!
|
|
|
|
Geises Versuch, eine jahrelange Dummheit zu
leugnen, ist nicht die einzige Lüge in seinem aktuellen Artikel. Wir
werden in Teil 5 näher darauf eingehen.
|
|
3.2
|
|
3.2 Wer hat Aldrin fotografiert?
|
|
|
|
 Wer
hat eigentlich "Buzz" Aldrin bei seinem Ausstieg aus der
Fähre fotografiert? Sein Ausstieg ist in mehreren Phasen säuberlich
auf exzellent ausgeleuchteten Fotos dokumentiert. Dazu heißt es
(natürlich), Armstrong hätte ihn fotografiert. Doch die
Fernseh-Direktübertragung zeigt etwas ganz anderes! So sieht man
beispielsweise in der Direktübertragung, wie Neil Armstrong, während
Aldrin noch in der Fähre ist, um diese herum hüpft. Dann begibt
er sich in den Bildhintergrund neben die Ausstiegsleiter und wartet
dort ab, bis Aldrin ausgestiegen ist. Kennt man die Hasselblad-Fotos
von APOLLO 11 von Aldrins Ausstieg (siehe S.86), so fragt man sich
unwillkürlich, wer eigentlich die Ausstiegsfotos gemacht hat, denn
Armstrong stand - wie in der TV-Direktübertragung einwandfrei zu
sehen war - in einem solch unglücklichen Winkel hinter Aldrin, dass
er ihn unmöglich frontal fotografiert haben konnte, wie es die Bilder
zeigen. ["Die
Schatten von Apollo" S.86-88] Wer
hat eigentlich "Buzz" Aldrin bei seinem Ausstieg aus der
Fähre fotografiert? Sein Ausstieg ist in mehreren Phasen säuberlich
auf exzellent ausgeleuchteten Fotos dokumentiert. Dazu heißt es
(natürlich), Armstrong hätte ihn fotografiert. Doch die
Fernseh-Direktübertragung zeigt etwas ganz anderes! So sieht man
beispielsweise in der Direktübertragung, wie Neil Armstrong, während
Aldrin noch in der Fähre ist, um diese herum hüpft. Dann begibt
er sich in den Bildhintergrund neben die Ausstiegsleiter und wartet
dort ab, bis Aldrin ausgestiegen ist. Kennt man die Hasselblad-Fotos
von APOLLO 11 von Aldrins Ausstieg (siehe S.86), so fragt man sich
unwillkürlich, wer eigentlich die Ausstiegsfotos gemacht hat, denn
Armstrong stand - wie in der TV-Direktübertragung einwandfrei zu
sehen war - in einem solch unglücklichen Winkel hinter Aldrin, dass
er ihn unmöglich frontal fotografiert haben konnte, wie es die Bilder
zeigen. ["Die
Schatten von Apollo" S.86-88]
|
|
 Hier
lässt sich nichts deuten. [aus
einer Email vom 17.12.2003] Hier
lässt sich nichts deuten. [aus
einer Email vom 17.12.2003]
|
|
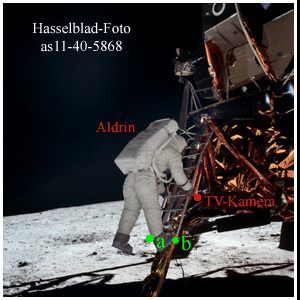 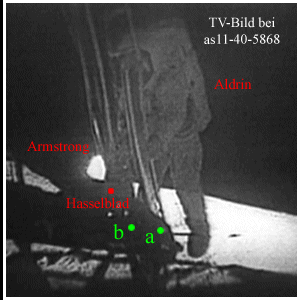 |
|
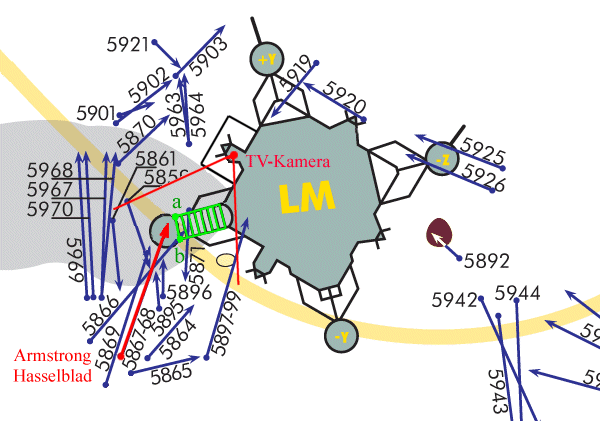 |
|
|
|
Armstrong hat Aldrin nicht frontal (von vorne [3]) fotografiert, wie Geise
schreibt, sondern schräg von hinten. Die TV-Kamera
(big)
nahm
Aldrin schräg von vorne auf und filmte somit durch Leiter und
Landegestell hindurch. Foto- und TV-Kameras waren, zu diesem
Zeitpunkt, aufeinander gerichtet. Zur räumlichen Orientierung sind die
Eckpunkte der untersten Leitersprosse mit a und
b bezeichnet. Wir
können keinen Widerspruch bei TV-Übertragung und Fotos feststellen.
|
|
3.3
|
|
3.3 Die Aufstellung des
Laserreflektors
|
|
|
Laserreflektoren wurden von Apollo11, 14 und 15
aufgestellt. Sie sind auch heute noch von großem wissenschaftlichen
Nutzen und ganz nebenbei überzeugene Belege für Apollo. Für
Fachleute sind sie überzeugende Belege - für Gernot Geise
selbstverständlich nicht.
|
|
|
|
 Schaut
man sich Fotos von APOLLO 11 an, so muß man verwundert feststellen,
dass der Reflektor (Pfeil)
nicht etwa flach auf dem Mondboden aufgelegt,
sondern in einem Winkel von etwa 28° schräg aufgestellt wurde. Wohin
zeigt der Reflektor dann? Wie jeder weiß, zeigt der Mond immer die
selbe Seite zur Erde. Da APOLLO 11 etwa in der Mitte der sichtbaren
Mondscheibe gelandet war (sein soll!), müsste der Reflektor flach auf
den Mond aufgelegt werden und senkrecht in den (Mond-) Himmel
zeigen, sonst kann er gar nicht funktionieren! ["Dunkle
Seite Apollo" S.249] Schaut
man sich Fotos von APOLLO 11 an, so muß man verwundert feststellen,
dass der Reflektor (Pfeil)
nicht etwa flach auf dem Mondboden aufgelegt,
sondern in einem Winkel von etwa 28° schräg aufgestellt wurde. Wohin
zeigt der Reflektor dann? Wie jeder weiß, zeigt der Mond immer die
selbe Seite zur Erde. Da APOLLO 11 etwa in der Mitte der sichtbaren
Mondscheibe gelandet war (sein soll!), müsste der Reflektor flach auf
den Mond aufgelegt werden und senkrecht in den (Mond-) Himmel
zeigen, sonst kann er gar nicht funktionieren! ["Dunkle
Seite Apollo" S.249]
|
|
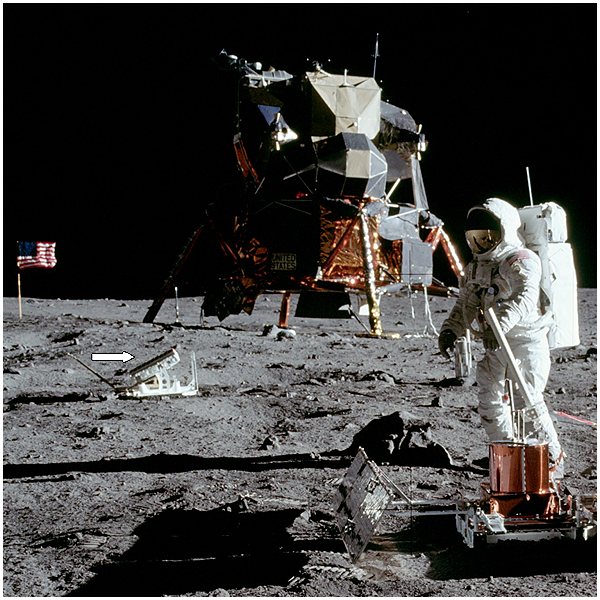 |
|
|
Apollo 11 ist zwar in der Nähe des
Mondäquators
gelandet, aber nicht in der Mitte der "sichtbaren Mondscheibe" (Apollo-Landestellen).
Gernot Geise
unterschlägt hier einfach eine Raumdimension, als wenn der Mond nur in
eine Richtung gekrümmt wäre. Der Landeplatz von Apollo11 liegt 23,47° östlich des
Nullmeridian und erfordert somit eine entsprechende Neigung des
Reflektors [4].
|
|
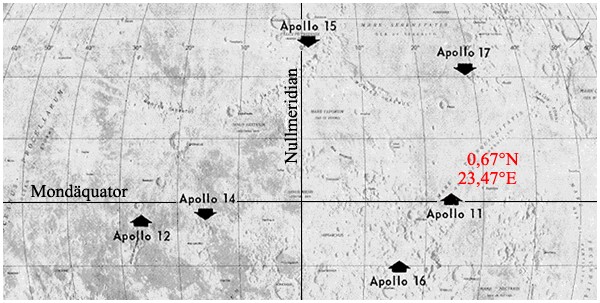 |
|
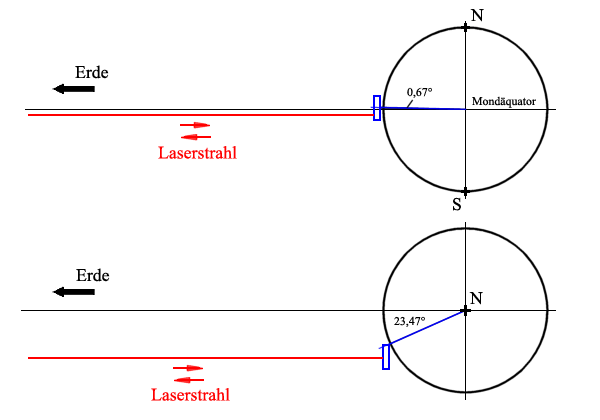 |
|
Wenn wir auf den Apollo11-Fotos die Ausrichtung des
Retroreflektors zum
Horizont messen, sehen wir, dass der Winkel nicht diesem Wert von 23,47° entspricht, sondern
annähernd 28°. Wir wissen allerdings auch nicht, ob der
sichtbare Horizont wirklich dem theoretisch idealen Horizont
entspricht, denn auch das Mare Tranquillitatis ist
nicht völlig eben. Das stellt aber kein Problem dar, denn die
Tripelspiegel sind selbst bei Abweichungen von ca. ±15°
noch brauchbar. Die
Librations-Bewegung des Mondes (6° 47' in Breite und 7° 53' in Länge)
ist deshalb ebenfalls unkritisch.
|
|
|
Dass die Erde nicht direkt über der
Landestelle von Apollo11 stand, wie Geise fälschlich annimmt, wird
deutlich mit den Aufnahmen 5923
und 5924.
Im Foto oben (5949),
sowie in 5947-5950,
ist zudem erkennbar, dass die stabförmige Low-Gain-Antenne des Seismometers im
gleichen Winkel ausgerichtet ist. Auch die Parabolantenne auf dem Dach der
Mondfähre ist zur Erde gerichtet (siehe Foto 5872). Es kann also von allen Seiten
Entwarnung gegeben werden. Die von Gernot Geise propagierten Widersprüche
gibt es nicht. |
| 3.4 |
|
3.4 Die Entfernung Erde-Mond
|
|
|
|
 Die
genau Entfernung zwischen Erde und Mond ist merkwürdigerweise bis
heute nicht bekannt, obwohl sie durch eine ganze Reihe von Mondsonden
und die "APOLLLO-Flüge" doch eigentlich millimetergenau
bekannt sein müsste. Die nachfolgende Tabelle
(Bild)
zeigt die
Entfernungsangaben, die beispielsweise bei den einzelnen
APOLLO-Missionen ermittelt wurden. Die Tabelle zeigt in den
Entfernungsangaben eine Diskrepanz von 29635km! Wie ist es möglich,
dass (zwischen APOLLO8 mit der niedrigsten Entfernungsangabe und
APOLLO15 mit der höchsten Entfernungsangabe) so unterschiedliche
Entfernungen angegeben werden? Ein paar hundert Kilometer plus/minus
mögen noch mit Schwankungen in der Mondumlaufbahn erklärbar sein,
meinetwegen auch ein paar tausend, doch fast dreißigtausend
Kilometer? Da kann doch etwas nicht stimmen!
["Die
dunkle Seite von Apollo" S.62/63] Die
genau Entfernung zwischen Erde und Mond ist merkwürdigerweise bis
heute nicht bekannt, obwohl sie durch eine ganze Reihe von Mondsonden
und die "APOLLLO-Flüge" doch eigentlich millimetergenau
bekannt sein müsste. Die nachfolgende Tabelle
(Bild)
zeigt die
Entfernungsangaben, die beispielsweise bei den einzelnen
APOLLO-Missionen ermittelt wurden. Die Tabelle zeigt in den
Entfernungsangaben eine Diskrepanz von 29635km! Wie ist es möglich,
dass (zwischen APOLLO8 mit der niedrigsten Entfernungsangabe und
APOLLO15 mit der höchsten Entfernungsangabe) so unterschiedliche
Entfernungen angegeben werden? Ein paar hundert Kilometer plus/minus
mögen noch mit Schwankungen in der Mondumlaufbahn erklärbar sein,
meinetwegen auch ein paar tausend, doch fast dreißigtausend
Kilometer? Da kann doch etwas nicht stimmen!
["Die
dunkle Seite von Apollo" S.62/63]
(In Arbeit)
Was Geise hier Wortreich beschreibt, ist seine Unkenntnis
über die Ellipsenbahn des Mondes.
|
|
Bahnexentrizität: 0,0549 → 384.000km
±5,49% → >40.000km Differenz
|
|
Solche fundamentalen Unkenntnisse disqualifizieren ihn
für jede Art von Kritik an Apollo.
|
|
3.5
|
|
3.5 LM und CSM im
Mondorbit
|
|
|
 Das
Kommando- und Servicemodul (CSM) von APOLLO 15 vor der Mondoberfläche
(links). Moment, hier stimmt doch etwas
nicht! Wie ist es möglich, dass die Fähre ÜBER dem CSM fliegt? Sie
ist doch nach dem Abkoppeln nach unten geflogen, während das CSM in
der Umlaufbahn blieb. Auch bei der Rückkehr kam das Retroteil von
unten, nicht von oben, um wieder anzukoppeln. Das
Kommando- und Servicemodul (CSM) von APOLLO 15 vor der Mondoberfläche
(links). Moment, hier stimmt doch etwas
nicht! Wie ist es möglich, dass die Fähre ÜBER dem CSM fliegt? Sie
ist doch nach dem Abkoppeln nach unten geflogen, während das CSM in
der Umlaufbahn blieb. Auch bei der Rückkehr kam das Retroteil von
unten, nicht von oben, um wieder anzukoppeln.
|
|
|
 Auch
hier (Bild rechts) befindet sich das CSM
von APOLLO 16 wieder unterhalb der Fähre, was (siehe Diagramm)
gar nicht möglich war. ["Die Schatten von Apollo"
S.72/73] Auch
hier (Bild rechts) befindet sich das CSM
von APOLLO 16 wieder unterhalb der Fähre, was (siehe Diagramm)
gar nicht möglich war. ["Die Schatten von Apollo"
S.72/73]
|
|
 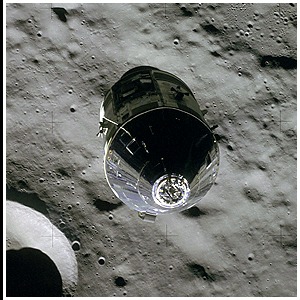 |
|
|
Gernot Geise läßt sich hier von einer sehr
naiven Vorstellung leiten. Ganz offensichtlich nimmt er an, eine
Mondlandung entspräche durchgängig einem vertikalen Abstieg, ähnlich einem
Fahrstuhl. Tatsächlich wird die Landung aus einer elliptischen
Umlaufbahn eingeleitet, an deren niedrigstem Punkt
(ca.15km Höhe) das eigentliche Brems- und Landemanöver beginnt. Mit dem Bremsvorgang
richtet sich die Mondfähre, aus zunächst
horizontalen Fluglage, nach und nach auf, um schließlich vertikal auf
dem Mond zu landen (siehe Diagramm). Beim Abtrennen
von der Apollokapsel ist es egal, ob sich die
Mondfähre gerade über oder unter ihr befindet, denn es ist von
diesem Zeitpunkt an noch mehr als ein Mondumlauf (ca.2,5h) bis zur eigentlichen Landung.
Bei einer
Bahnhöhe von etwa 110km, spielen ein paar Meter wirklich keine
Rolle. |
|
Bei der Rückkehr der LM-Oberstufe ist es ähnlich. Die
Mondfähren brauchen mindestens einen (Apollo14-17) oder sogar
zwei Umläufe (Apollo10-12) um die Kommandokapseln zu erreichen. Wenn sich
die Kreisbahnen der beiden Raumschiffe dabei auf einige Hundert Meter genau
treffen, ist das
schon sehr gut. Der Rest ist Feinarbeit. So näherten sich einige
Mondfähren dem CSM von oben (z.B. Apollo15), andere hatten einen geringfügig niedrigeren Orbit
(z.B. Apollo16).
|
|
|
|
Und wieder fällt Geise diese "Unstimmigkeit" nur bei der Mondlandung
auf, nicht aber bei Skylab, Saljut, MIR oder ISS. Es gibt
unzählige Fotos und Filme, die diese Raumstationen von oben zeigen, obwohl doch
die Zubringer-Raumschiffe Apollo,
Sojus oder Space Shuttle immer von unten (von der Erdoberfläche) kommen.
Das gleiche gilt für das Hubble-Spacetelescope (rechts unten).
|
|
|
 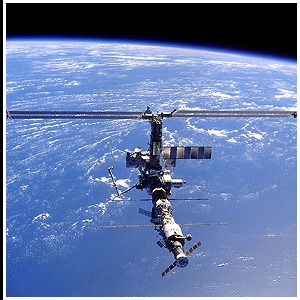 |
|
|
 
|
|
|
|
In "Die
Schatten von Apollo" findet sich auf S.115 ein Bild von der
ISS (ähnlich Foto rechts oben), allerdings ohne Widerspruch. Gernot
Geise ist in Wahrnehmung und Urteil sehr sprunghaft. An der
heutigen Raumfahrt hat er nicht viel auszusetzen. Wenn es aber um Apollo geht, wird
eine andere Brille aufgesetzt, ein anderer Maßstab angelegt und eine
andere Logik verwendet.
|
|
|
|
 Dabei
ist es so einfach - wenn man es durchschaut!
[Weblink] Dabei
ist es so einfach - wenn man es durchschaut!
[Weblink]
|
|
3.6
|
|
3.6
Gernot Geise berechnet Umlaufbahnen
|
|
|
|
 Wie
bekannt, besitzt die Erde einen Durchmesser von rund 12.750km, der
Mond einen solchen von rund 3476km. Um einmal die Erde zu umkreisen,
benötigt ein Raumfahrzeug (etwa ein Space Shuttle) neunzig Minuten.
Im Vergleich dazu müsste eine Umkreisung des Mondes demgemäß knapp
25 Minuten dauern. Doch - oh Wunder - dem ist nicht so. APOLLO 8 (der
erste "bemannte Mondflug") benötigte für zehn
Mondumkreisungen geschlagene zwanzig Stunden, das sind pro
Mondumkreisung volle zwei Sunden (NASA-Angaben). [Auch über den Weltraum wird
gelogen S.164] Wie
bekannt, besitzt die Erde einen Durchmesser von rund 12.750km, der
Mond einen solchen von rund 3476km. Um einmal die Erde zu umkreisen,
benötigt ein Raumfahrzeug (etwa ein Space Shuttle) neunzig Minuten.
Im Vergleich dazu müsste eine Umkreisung des Mondes demgemäß knapp
25 Minuten dauern. Doch - oh Wunder - dem ist nicht so. APOLLO 8 (der
erste "bemannte Mondflug") benötigte für zehn
Mondumkreisungen geschlagene zwanzig Stunden, das sind pro
Mondumkreisung volle zwei Sunden (NASA-Angaben). [Auch über den Weltraum wird
gelogen S.164]
|
|
|
|
Wenn man die Realität ausklammert, ist das eine echte
Unstimmigkeit! Was in der Überlegung fehlt, ist die wesentlich
geringere Gravitation des Mondes und damit die geringere Umlaufgeschwindigkeit.
Die Geschwindigkeit eines Raumschiffes im Erdorbit beträgt rund 7,9km/s, die im Mondorbit
aber nur ca.1,67km/s. Bei einer Bahnhöhe von 110km (bei Apollo8) ergeben sich
daher fast 2h für eine Mondumkreisung.
|
|
|
|
Auch diese Behauptung stammt nicht von Geise selbst. Er
hat sie von nasascam,
einer Webseite, die mit so dümmlichen Behauptungen aufwartet, dass man zunächst eine Satire vermuten könnte. Die Diskussionen
in verschiedenen Foren zeigen aber, Betreiber Sam Colby meint es
wirklich ernst. Wer einfachste Zusammenhänge nicht versteht, es nicht vermag
simpelste Berechnungen anzustellen und zudem so leichtgläubig ist wie
Gernot Geise, ist solchen Spinnern schutzlos ausgeliefert.
|
|
|
|
 Meine
Ideen beziehe ich nicht aus irgendwelchen ominösen Kanälen, denn ich
kann selbst denken und eins und eins zusammenzählen. ["Die
Schatten von Apollo" S.13] Meine
Ideen beziehe ich nicht aus irgendwelchen ominösen Kanälen, denn ich
kann selbst denken und eins und eins zusammenzählen. ["Die
Schatten von Apollo" S.13]
|
|
3.7
|
|
3.7
Die Größe der Erde in den Apollofotos
|
|
|
 Da
die Erde vom Mond genau so weit entfernt ist wie der Mond von der
Erde, dieser jedoch nur einen Bruchteil der Größe der Erde aufweist,
müsste die Erde, vom Mond aus gesehen, mindestens dreimal so groß
erscheinen wie der Mond am irdischen Himmel. Und wie sieht die Erde
auf den APOLLO-Bildern aus? Noch kleiner, als der Mond von der Erde
aussieht
(Bild links). Etwa
so groß (wie rechts) müsste die Erde von der Mondoberfläche aus erkennbar sein,
und nicht so winzig, wie es die APOLLO-Fotos zeigen! ["Die dunkle
Seite von Apollo" S.115-117] Da
die Erde vom Mond genau so weit entfernt ist wie der Mond von der
Erde, dieser jedoch nur einen Bruchteil der Größe der Erde aufweist,
müsste die Erde, vom Mond aus gesehen, mindestens dreimal so groß
erscheinen wie der Mond am irdischen Himmel. Und wie sieht die Erde
auf den APOLLO-Bildern aus? Noch kleiner, als der Mond von der Erde
aussieht
(Bild links). Etwa
so groß (wie rechts) müsste die Erde von der Mondoberfläche aus erkennbar sein,
und nicht so winzig, wie es die APOLLO-Fotos zeigen! ["Die dunkle
Seite von Apollo" S.115-117]
|
|
 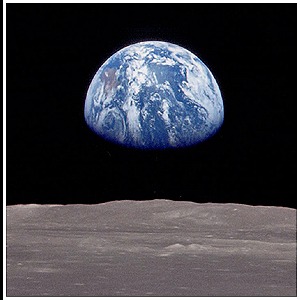 |
|
|
Eine Beurteilung nach Augenschein: "Die Erde müsste
viel größer sein!"
|
|
Doch wie groß muss die Erde auf den Apollofotos
wirklich zu sehen sein? Dazu brauchen nur die realen
Größenverhältnisse, mit denen auf den Fotos verglichen werden. Die
Grafik macht deutlich, dass die geometrischen Verhältnisse in der Realität
(blau) und im Foto (grün) identisch sein müssen. Der Quotient aus
"Objektiv-Bildwinkel" und "Erdwinkel" muss dem Quotient aus
"Bildbreite" und "Erddurchmesser auf dem Bild" entsprechen. Für eine solide
Berechnung ist alles gegeben: Der Radius der Erde (6371km), die
durchschnittliche Mondentfernung (384.000km), der horizontale Bildwinkel des
Objektivs (49,2°), die Breite eines Apollofotos (z.B. 2349Pixel von 5924)
und der Erddurchmesser auf diesem Foto (96Pixel). |
|
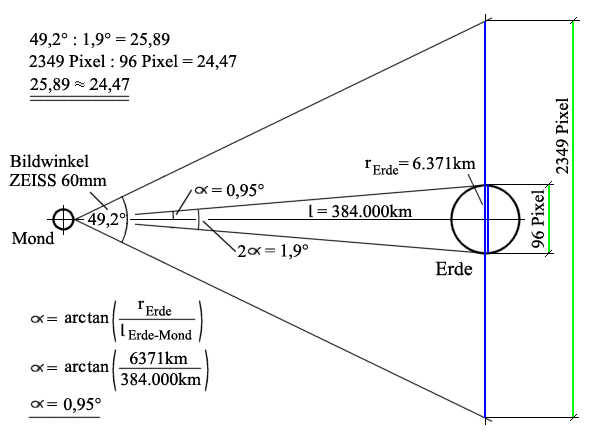
|
|
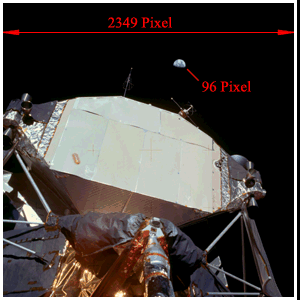  |
|
|
Wenn jetzt das Verhältnis
"Objektiv-Bildwinkel" zu "Erdwinkel" mit dem
Verhältnis "Fotobreite" zu "Erddurchmesser auf dem
Foto" verglichen wird, ergeben sich etwa gleiche Werte: 25,89 ≈ 24,47 In unserem Beispiel
beträgt die Abweichung weniger als 6% (±3%), was noch innerhalb der
Mondbahn-Exzentrizität von ca.±5% liegt [6]. Rein rechnerisch gibt
es also keine Beanstandung.
|
|
|
|
Entfernungs- und Größenschätzungen sind oft mit gravierenden Fehlern verbunden. Wie
sehr man sich gerade bei der Mondgröße vertun kann, ist z.B. auf den
Webseiten Mondillusion
und Summer
Moon Illusion anschaulich beschrieben. Wie groß der Mond auf einem
"Erdfoto" abgebildet wird, zeigt ein
Vergleichsfoto, welches bei ähnlichen Bedingungen entstanden ist. Die Halberde
ist vom Mond aus gesehen etwa 3,69x größer als der Vollmond
von der Erde gesehen. Dies kommt dem tatsächlichen Ø-Verhältnis
Erde/Mond von 3,667 sehr nahe. Die Erde ist auf den Apollofotos
also in der richtigen Größe abgebildet. Wenn gefälscht, dann
richtig gefälscht!
|
|
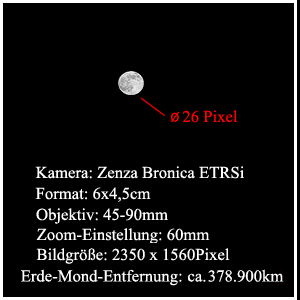 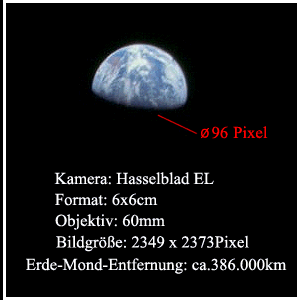 |
| 3.8 |
|
3.8
Die Höhe der Erde über dem Mondhorizont
|
|
|
|
 Von
der Mondoberfläche aus gesehen muss die Erde immer in der selben
Position am Himmel stehen und in einem festen Winkel über dem
Mondhorizont. Nun gibt es jedoch APOLLO-Fotos, auf denen die Erde
nicht nur im Umfang unterschiedlich groß ist, sondern auch in
verschiedenen Winkeln am "Mondhimmel" steht. Bei der APOLLO
17-Mission müsste aufgrund der Koordinaten (20,16N; 30,77O) die
Erde bei 54 Grad über dem lunaren Horizont, also recht hoch stehen.
Tatsache ist jedoch, dass die Erde recht niedrig über dem Horizont
steht (Bild links), und nicht etwa auf jedem Bild in der selben Höhe. ["Die
Schatten von Apollo" S.342/343] Von
der Mondoberfläche aus gesehen muss die Erde immer in der selben
Position am Himmel stehen und in einem festen Winkel über dem
Mondhorizont. Nun gibt es jedoch APOLLO-Fotos, auf denen die Erde
nicht nur im Umfang unterschiedlich groß ist, sondern auch in
verschiedenen Winkeln am "Mondhimmel" steht. Bei der APOLLO
17-Mission müsste aufgrund der Koordinaten (20,16N; 30,77O) die
Erde bei 54 Grad über dem lunaren Horizont, also recht hoch stehen.
Tatsache ist jedoch, dass die Erde recht niedrig über dem Horizont
steht (Bild links), und nicht etwa auf jedem Bild in der selben Höhe. ["Die
Schatten von Apollo" S.342/343]
|
|
 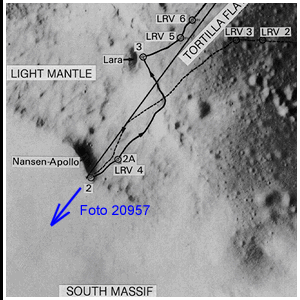 |
|
|
|
Die Angabe der Erdposition von 54° ist richtig (genau
53,2°). Dies aus den Landekoordinaten von Apollo17 zu ermitteln,
erfordert die Anwendung des "Satz des Pythagoras",
und Geise
hat mehrfach bewiesen, dass er das nicht kann. So ist es auch nicht
verwunderlich, wenn sich nach einer kurzen Recherche ergibt, dass er
das bei David
Wozney abgeschrieben hat. Doch das eigentliche Problem liegt woanders. Das
Foto as17-137-20957
zeigt nicht die Erde über dem Horizont, sondern die Erde über einem
Bergrücken! Astronaut Cernan hat hier an Station 2 (Nansen-Krater) am
Hang des sogenannten "South Massif" hoch fotografiert, wie
es auf dem Bild rechts zu sehen ist. Auf diesem
Orbitfoto
sieht man noch besser, dass der Krater Nansen direkt am Fuße des
"South Massif" liegt. Das Taurus-Littrow-Tal ist gänzlich
von Bergen umgeben, daher ist der Horizont auf den Fotos nur
stellenweise als Grenze zum schwarzen Himmel zu sehen (siehe A17-Panorama).
|
|
|
Einer der wenigen Aufnahmen von Apollo17, in der
Horizont und Erde gleichzeitig zu sehen sind, ist as17-134-20473
(unten).
Hier können wir den tatsächlichen Erdstand überprüfen. Die Kreuze
auf der Reseau Plate
haben einen Abstand von genau 10mm, was beim verwendeten 60mm-Objektiv 10,3° entspricht. Wenn der Erdstand
am Landeplatz von Apollo17 53° beträgt, muss der Abstand Erde-Horizont
im Foto
etwa 5,15x größer sein als der Abstand der Kreuze. Wie jeder nachprüfen kann, ist das der Fall [7]. Wenn
gefälscht, dann richtig gefälscht! |
|
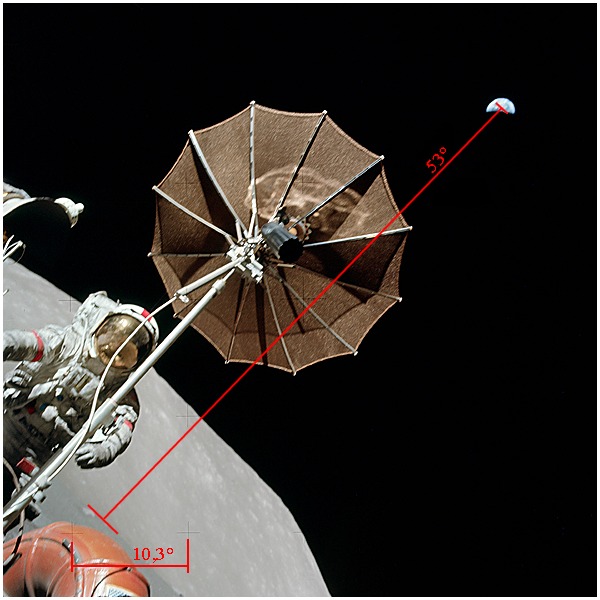 |
| 3.9 |
|
3.9 Die
Flugfähigkeit der Mondfähre
|
|
|
|
Eines der Lieblingsobjekte der Autoren ist
die Apollo-Mondfähre. Bevor wir im
nächsten Kapitel einige von Geises eigenen Thesen betrachten, sollte
zunächst die immer wieder gestellte Frage beantwortet werden, ob die
Mondfähre auf einem einzigen Triebwerksstrahl schweben und landen konnte? Der
erste
der dies anzweifelte war Ralph
Rene. Er stellte 1992 in
seinem Buch NASA
MOONED AMERICA folgende Behauptung auf:
|
|
|
|
 Die
Mondfähre hatte für die Landung nur ein Triebwerk, und ist damit
praktisch nicht steuerbar gewesen. Schon eine geringe
Schwerpunktsverlagerung (z.B. ein kleiner Schritt eines Astronauten im
Inneren), müßte die Mondfähre zum Kippen und Absturz bringen. Die
Computer waren damals nicht leistungsfähig genug um solche Fluggeräte
zu Steuern. [Buch]
[Die
Akte Apollo] Die
Mondfähre hatte für die Landung nur ein Triebwerk, und ist damit
praktisch nicht steuerbar gewesen. Schon eine geringe
Schwerpunktsverlagerung (z.B. ein kleiner Schritt eines Astronauten im
Inneren), müßte die Mondfähre zum Kippen und Absturz bringen. Die
Computer waren damals nicht leistungsfähig genug um solche Fluggeräte
zu Steuern. [Buch]
[Die
Akte Apollo]
|
|
|
|
Soweit
die Ausführungen von Ralph Rene in Kurzform. Dieses Argument wirkt auf viele Laien
sehr überzeugend, tatsächlich aber ist es reinster Unsinn.
Ein Fluggerät kann sehr wohl mit nur einem einzigen Triebwerk fliegen
und schweben - auch ohne Computersteuerung! Ein gutes Beispiel ist das Experimentalflugzeug
"X-13 Vertijet" von 1956 (Bild
01 / Bild 02 / Bild
03 / Bild
04 / Weblink
01 / Weblink
02).
Dieser sogenannte Heckstarter schwebte bei Start und Landung nur auf dem
Strahl des Haupttriebwerks. Das schwenkbare Strahltriebwerk (die erste Schubvektorsteuerung dieser
Art in einem Flugzeug) balancierte die "X-13" ähnlich wie man einen
Besenstiel auf dem Finger balanciert (Filmclip).
Nur für die Drehung um die Hochachse hatte die X-13 kleine Steuerdüsen
an den Flügelenden. Ein unbemannter Prototyp flog sogar schon 1950 (Bild).
|
|
|
|
Die Heckstarter "Atar Volant 400" (Bild
01 / Bild
02 / Weblink)
und "Coléoptère C450" (Bild
01 / Bild
02 / Bild
03 / Weblink)
des französischen Flugzeugbauers SNECMA sind weitere Beispiele. Die
unbemannte "Atar Volant 400 P.1" absolvierte bis
Dezember 1956 163 erfolgreiche Flüge. Damit waren akrobatische
Flugfiguren und Punktlandungen möglich. Selbst starker Wind und orkanartige Böen
wurden von der Steuerung automatisch ausgeglichen. Die Lagestabilisierung
war so genau und feinfühlig, dass sie beim Flug nicht
sichtbar und für einen Piloten auch nicht spürbar war. Die bemannte Version
"400 P.2" flog unter anderem auf der Pariser
Luftfahrtschau 1957. Ein VDI-Bericht
von 1957 beschreibt die technischen Grundlagen und die Ergebnisse der Testflüge.
|
|
|
|
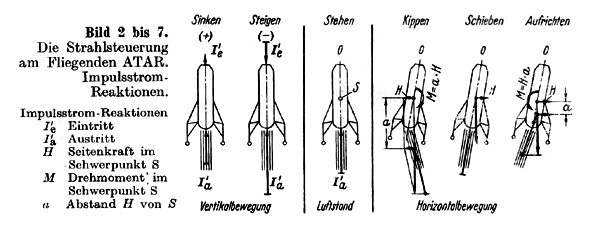
|
|
|
|
Die Möglichkeit von Schwebeflug und Landung, mit nur einem
Triebwerk, ist damit hinreichend bewiesen. Tatsächlich ist es
sogar einfacher eine Mondfähre über dem Mond schweben zu lassen,
als einen Senkrechtstarter über der Erde. Die geringe Gravitation
läßt eine Mondfähre langsamer zur Seite kippen, die Steuerung braucht
daher nicht so reaktionsschnell sein. Es gibt auf dem Mond auch keinen
Wind, der eine Mondfähre aus der Balance bringen könnte. Die oben
beschriebenen Fluggeräte sind bereits 10-18 Jahre vor der ersten Mondlandung mit analoger
Elektronik erfolgreich geflogen. Zweifel an den Flugfähigkeiten der computergesteuerten
Mondfähre,
bei vergleichsweise einfachen Bedingungen, sind also unbegründet.
|
|
|
|
Der Vergleich der Apollo-Mondfähre mit "X-13 Vertijet" "Atar Volant"
und "Coléoptère" ist viel sinnvoller als der häufig geführte Vergleich mit dem Senkrechtstarter Sea
Harrier. Der Harrier schwebt nicht auf einem, sondern auf 4 Triebwerksstrahlen und benötigt
für die Balance zusätzliche Steuerdüsen an den Flügelenden. Auch der
Mondfährensimulator LLTV
kann und sollte nicht direkt mit dem Apollo-LM verglichen
werden. Die Flüge mit dem LLTV waren nicht der Versuch eine Mondfähre auf der Erde fliegen zu lassen (wie häufig
geglaubt), sondern
den Piloten eine realistische Trainingsmöglichkeit für die letzte Phase der
Mondlandung zu geben. Die Schwierigkeit
ein LLTV im "lunar mode" zu steuern, lag darin, dass sich der Pilot
auf eine simulierte Mondgravitation einstellen musste. Die auf der Erde
antrainierten Reflexe eines Piloten sind bei der Steuerung einer Mondfähre
zunächst eher hinderlich und müssen umgestellt werden. Wenn sich
beispielsweise ein
Hubschrauber für den Vorwärtsflug um 5° nach vorne neigt, dann sind es bei
Mondfähre und LLTV etwa 28° (Bild). Die "elektronische Steuerung" hat es
auf dem Mond einfacher (siehe oben), die "menschliche
Steuerung" tut sich dagegen zunächst sehr schwer. Mit Apollo 11 stellte sich dann
heraus, dass das LLTV eine sehr gute und unverzichtbare Simulation darstellte. Die
Apollo-Mondfähre war sogar etwas einfacher zu steuern als das LLTV im
"lunar mode" - besser so als umgekehrt! Im "earth mode" verhielt
sich das LLTV ähnlich einem Hubschrauber, war für einen Piloten also recht
leicht zu fliegen.
|
|
|
|
In der Praxis war es bei der Mondfähre so, dass das
Landetriebwerk bei jeder Zündung zunächst 15s
bei 10% Schubkraft getrimmt wurde (vehicle stabilization / Bild).
In dieser Zeit konnte der Schubvektor
durch den Massenschwerpunkt ausgerichtet werden. Die Lage der Mondfähre
in Y- und Z-Achse (engl. pitch and roll / Bild) wurde allein durch
Schwenken des Hauptriebwerks (max ±6°) geregelt. Erst bei zu großen
Fehlern (zu starkes oder zu schnelles Kippen) hätten
auch die Korrekturtriebwerke angesprochen. Die Drehung um
die Hochachse X (engl. yaw) wurde nur mit den Korrekturtriebwerken
vorgenommen, da ein einzelnes Haupttriebwerk Bewegungen um diese Achse nicht
beeinflussen kann.
|
|
3.10
|
|
3.10 Die
Flugfähigkeit der Mondfähre mit
"angeflanschtem" Rover
|
|
|
|
 Und,
anscheinend um der Sache noch eine „Krone“ aufzusetzen, waren bei
den Landungen der APOLLO 15 bis 17-Fähren an einer Seite der Fähren
die Mondrover angeflanscht. Nun weiß jeder Pilot, wie problematisch
die Flugstabilität wird, wenn in einem Flugzeug nur allein das
Gepäck nicht gleichmäßig verstaut ist. Die einseitige
Gewichtsbelastung der Landefähren durch die „Rover“ hätte bei
der Navigation zu allergrößten Stabilitätsproblemen
der ohnehin
problematisch zu steuernden Landefähren führen müssen. Doch bei der
Steuerung und der Landung der Mondfähren störte die einseitige
Belastung merkwürdigerweise anscheinend überhaupt nicht!
[8] ["Die dunkle Seite von Apollo"
S.77-79] Und,
anscheinend um der Sache noch eine „Krone“ aufzusetzen, waren bei
den Landungen der APOLLO 15 bis 17-Fähren an einer Seite der Fähren
die Mondrover angeflanscht. Nun weiß jeder Pilot, wie problematisch
die Flugstabilität wird, wenn in einem Flugzeug nur allein das
Gepäck nicht gleichmäßig verstaut ist. Die einseitige
Gewichtsbelastung der Landefähren durch die „Rover“ hätte bei
der Navigation zu allergrößten Stabilitätsproblemen
der ohnehin
problematisch zu steuernden Landefähren führen müssen. Doch bei der
Steuerung und der Landung der Mondfähren störte die einseitige
Belastung merkwürdigerweise anscheinend überhaupt nicht!
[8] ["Die dunkle Seite von Apollo"
S.77-79]
|
|
|
Was für eine verwegene Idee, dass man den Rover
einfach seitlich an der Mondfähre angebracht hat, ohne den
Schwerpunkt zu beachten! Diese Behauptung bedeutet im Klartext: "Die
Ingenieure und Techniker der Firma Grumman sind ausgemachte Dummköpfe.
Und
ich Gernot L. Geise bin weltweit der einzige der das bemerkt hat."
|
|
|
Versuchen wir mal genauer zu ergründen, was an Geises Vorstellung
dran ist:
|
Die Mondautos (Lunar Roving Vehicle / LRV) waren eine, aber nicht die einzige Besonderheit bei den letzten drei Mondlandungen. Bei den Mondfähren
ab Apollo15
gab es viele Hundert
kleine und große Änderungen [9]. Dazu gehörten unter anderem ein effizienteres
Landetriebwerk, vergrößerte
Treibstofftanks, zusätzliche Batterien, Wasser- und Sauerstofftanks.
Durch diese Verbesserungen konnte mehr
Nutzlast (Rover und wissenschaftliche Geräte) mitgenommen werden, die Astronauten über 70h auf dem Mond bleiben
(bis dahin nur 30h), sowie drei Mondausflüge (vorher nur zwei) durchgeführt werden. Aufgrund der
Konstruktionsänderungen und der
zusätzlichen Nutzlast war die gesamte Landestufe anders aufgeteilt. Einige
dieser Modifikationen sind in der
Zeichnung dargestellt. Besonders auffällig: Außen an Ladebucht QUAD III
war eine zusätzliche Nutzlast
angebracht. Diese hätte sicher auch innerhalb der Ladebucht Platz gefunden, wurde aber weiter nach außen
gesetzt
und bildete so ein
Gegengewicht zum Rover in QUAD I . Siehe auch LM
- QUAD III. |
|
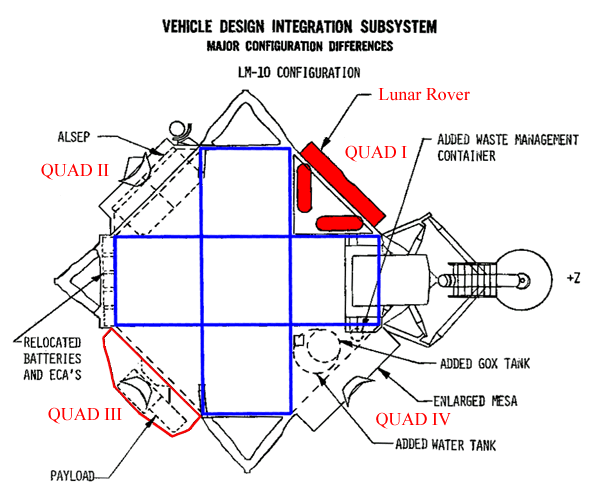 |
|
|
Interessant auch, dass die Nutzlast von QUAD III Teile des
Rovers enthält (Bild). Tatsächlich war nur das Rover-Chassis an QUAD I
angebracht,
die Aufbauten (Antenne, TV-Kamera, Batterien usw.) aber auf die anderen Ladebuchten verteilt.
Bekanntlich musste der Lunar-Rover von den Astronauten
erst zusammengebaut
werden. Ein Fotovergleich zeigt die Unterschiede: QUAD III
ist bei Apollo11 flach (Bild links). Bei Apollo15 (rechts) ist der
angehängte Nutzlastteil zu sehen. Gernot Geises Behauptung von einseitig belasteten Mondfähren ist
also falsch!
|
|
 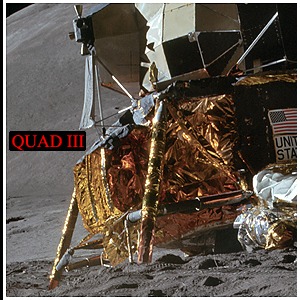 |
|
|
|
Man kann sich über Geises Unwissenheit
wundern, aber auch über seinen Umgang mit praktischen Problemstellungen. Es
ist überaus einfach den Schwerpunkt eines Objekts zu bestimmen.
Man braucht kein Raumfahrt-Ingenieur zu sein, um auf die naheliegende und praktikable
Lösung zu kommen, die
Mondfähre einfach mittig aufzuhängen und die lotrechte Ausrichtung,
z.B. mit einer Wasserwaage, zu prüfen. Und so wurde es bei
Grumman natürlich auch gemacht - jedenfalls prinzipiell. Im Werk gab es
eine Abteilung, die für Ermittlung der einzelnen Gewichte (Massen) und
deren Verteilung zuständig war. Da sich der Dockingadapter der
Mondfähre konstruktionsbedingt
genau in einer Flucht mit den beiden Triebwerken befand, stellt er
einen idealen Aufhängungspunkt dar. Aus der Schieflage der
ausgependelten Fähre läßt sich dann leicht der
Schwerpunkt ermitteln. Die verschiedenen Nutzlasten der Landestufe (descent stage) waren auf Gleitern
befestigt, sodass der Schwerpunkt auf einfache Weise verlagert werden konnte. Dieser Vorgang wurde sowohl
mit dem gesamten LM durchgeführt, wie auch mit den getrennten Stufen. Für
das Gesamt-LM war die genaue Lage des Massenschwerpunkts unkritischer, da das
Haupttriebwerk vor der Landung getrimmt wurde (siehe 3.9). Ein leicht versetzter Schwerpunkt
wurde
daher augeglichen. Für die Aufstiegsstufe (ascent
stage), deren Haupttriebwerk
nicht schwenkbar ist, war es
besonders wichtig auf den Schwerpunkt zu achten. Vor dem Rückstart in den
Mondorbit mussten die Astronauten z.B. das Mondgestein an vier verschiedenen
Stellen in der LM-Kabine verstauen. Eine perfekte Balance kann es aber
nicht geben, sodass in den Filmen vom "lunar liftoff" eine
Oszillationsbewegung um zwei Achsen sichtbar ist (Filmclip
Apollo11 / besonders deutlich im Schnellvorlauf !). Bei
Raketen, die ein starres Triebwerk haben und nur mit
Korrekturtriebwerken gesteuert werden,
sind diese stärkeren Ausgleichsbewegungen normal. Das ist etwas, was Geise ebenfalls nicht versteht. Doch anstatt sich um echte Erkenntnis zu
bemühen, füllt er eine weitere Buchseite mit dieser angeblichen Unmöglichkeit
("Die Schatten von Apollo" S.109/110). Es beginnt, wie es meistens
beginnt (Eine
weitere Unmöglichkeit ist ebenfalls anscheinend niemand aufgefallen.).
Was folgt ist die gewohnte Mischung aus Unkenntnis (Man
sieht zunächst die hinwegfliegenden Verbindungsbolzen, ...), 3D-Wahrnehmungsstörung (Man
hat den Eindruck als wenn die Kapsel immer nur einige zehn Meter
aufsteigen würde, um dann kurz zu verharren.) und falscher Schlussfolgerung (Eine
völlige Unmöglichkeit für einen Raumflug.).
|
|
|
|
Es wurde nicht nur der Schwerpunkt der Mondfähre vor dem Flug
bestimmt, sondern auch während des Fluges. ... (ab
hier in Arbeit) Bild
|
|
|
|
 Die NASA argumentiert,
die Fähren seien mit Stabilisierungssystemen ausgestattet gewesen,
welche die ungleichmäßige Belastung automatisch ausgeglichen hätten.
Ich frage mich jedoch: wenn es schon damals solche Spezialgeräte gab, warum werden diese dann
nicht in Flugzeuge eingebaut? Die NASA argumentiert,
die Fähren seien mit Stabilisierungssystemen ausgestattet gewesen,
welche die ungleichmäßige Belastung automatisch ausgeglichen hätten.
Ich frage mich jedoch: wenn es schon damals solche Spezialgeräte gab, warum werden diese dann
nicht in Flugzeuge eingebaut?
|
|
|
|
Die NASA argumentiert so nicht / Es gab keine
ungleichmäßige Belastung. / Flugzeuge brauchen diese Art der Stabilisierung nicht. /
Autopiloten gibt es seit über 40 Jahren. / Schon Ende der 20er Jahre hatte
Raketenpionier Robert Goddard mit Kreiselstabilisierungen experimentiert
und ab 1932 erfolgreich eingesetzt. Die Autoren sind mit ihrem technischen
Sachverstand also gut 75 Jahre zurück. /
Selbst in preiswerten Modellhubschraubern ist ein Gyroskop eingebaut. /
Die Vought F-8 Crusader war erstes Flugzeug mit Fly-by-wire-System; Basis war der
Apollo-Computer (DFBW.pdf
S.10 / 14 / 35 / 48 / 63-64 / 68-Bild
/ 71-72Bild / 76 / ) / Die Boeing 747 der ersten
Generation hatte modifiziertes Apollo-Navigationssystem. Eine ungleichmäßige Belastung haben (hatten) die
sowjetische Energija (links), die Energija-Buran (Mitte) und der Space
Shuttle, besonders nach Abwurf der Feststoffbooster (rechts). Trotzdem
stürzen diese Raketen nicht ab, da der Schubvektor durch den
Massenschwerpunkt geht.
|
|
|
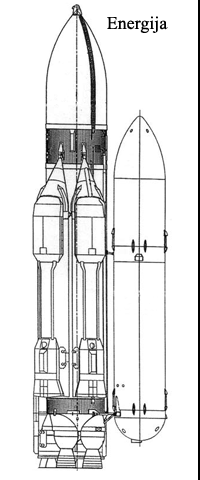 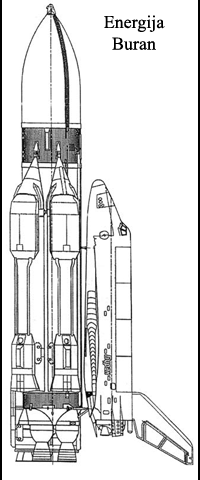 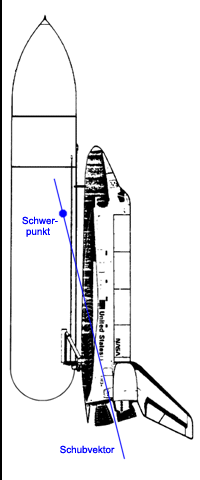
|
|
|
|
 Ich wundere mich, wieso solche Unmöglichkeiten
von der Öffentlichkeit aufgenommen wurden, ohne dass jemand stutzig
wurde. Es muss doch auch Piloten geben, welche die Unmöglichkeit
dieser Manöver aufzeigen können. Ich wundere mich, wieso solche Unmöglichkeiten
von der Öffentlichkeit aufgenommen wurden, ohne dass jemand stutzig
wurde. Es muss doch auch Piloten geben, welche die Unmöglichkeit
dieser Manöver aufzeigen können.
|
|
|
|
Die Tatsache, dass kein Fachmann protestiert, sollte
Gernot Geise selbst stutzig machen. / Piloten wissen eben wie Technik
funktioniert. ... / Aus der eigenen Unkenntnis eine Unstimmigkeit machen
→ siehe Egozentrismus (Kapitel
6.5)
|
|
3.11
|
|
3.11 Fazit |
|
|
|
Wie die Beispiele zeigen, vermag es Gernot Geise nicht die
dreidimensionale Realität zu begreifen. Er reit sich damit bei
seinen Autorenkollegen ein, die ebenfalls mehr oder weniger 3D-blind sind.
Bei der Beurteilung der Schattenverläufe zieht er den Einfluß der
Zentralperspektive nicht mal in Betracht. Das ist tragisch und
erstaunt umso mehr, da er behauptet vom Fach zu
sein.
|
|
|
|
Auch wenn es darum geht praktische Probleme der
Raumfahrt zu bewerten, versagt Geise auf ganzer Linie. Dabei sind es schon die
einfachsten Zusammenhänge, mit denen er nicht zu Rande kommt. Von
komplexen wissenschaftlichen oder technischen Vorgängen ganz zu
schweigen.
Ihm fehlt sowohl elementares Wissen (z.B. Mond dreht sich in Ellipsenbahn um
die Erde), wie auch die Fähigkeit zum logischen Denken. Geises Apollo-Analysen scheitern daher meist schon im Vorfeld, wo es gilt
ein Problem in den Grundzügen zu erfassen. Die Methoden wissenschaftlichen Arbeitens
scheinen ihm auch fremd zu sein.
|
|
|
|
|
0. |
|
Neben Filippo
Brunelleschi haben auch Leon
Battista Alberti, Piero
della Francesca, Tommaso
die Ser Cassai (Masaccio) und Albrecht
Dürer maßgeblich zur Entwicklung der Perspektiv-Gesetze beigetragen.
|
|
|
|
| 1. |
|
Genauer ausgedrückt, sind nur Schienen einer
geradlinigen Eisenbahntrasse
parallel. In einer Kurve liegen die Schienen konzentrisch zueinander.
|
|
|
|
| 2. |
|
Hier sind die Reste dieser
Galerie zu sehen: [Weblink]
|
|
|
Das es sich bei Gustav Eichl wirklich um Gernot
Geise handelt, erkennt man an der Weblink-URL, sowie aus Hinweisen anderer
Webseiten (atlantisforschung.de
/ Stimmen
astronomische Ausrichtungen?
/ usw.). |
|
|
|
| 3. |
|
Was meint Geise mit frontal? Frontal von vorne,
frontal von hinten oder frontal von der Seite? Nach Duden und Lexikon ist die
Definition: von vorne oder von der Stirnseite kommend. Demnach hat Armstrong Aldrin eindeutig nicht frontal
aufgenommen [5862
/
5863 / 5866
/ 5867
/ 5868
/ 5869].
Ist es nur Geises mangelhafte Raumorientierung oder auch eine Unfähigkeit sich
auszudrücken?
|
|
|
|
|
4. |
|
Der exakte Aufstellwinkel ergibt sich aus der Raumwinkelsumme von 0,67° und 23,47° und beträgt etwa 23,48°.
Berechnung über "Satz des Pythagoras" oder
"Trigonometrie".
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
Dark Moon Ausgabe
2003 S.???
|
|
|
|
|
| 6. |
|
Weitere Differenzen können sich
ergeben, durch eine Beschneidung des digitalen Bildes.
|
|
|
|
|
7. |
|
Zu beachten ist hier aber die Libration
des Mondes, wie schon in Kapitel 3.2 beschrieben. Die Schwankung um
6° 47' in Breite und 7° 53' in Länge, läßt eine Abweichung des Erdstandes
um ca. ±4° zu. Die Abweichung bei unserer Überschlagsrechnung liegt innerhalb
dieser Toleranz. Eine genauere Überprüfung läßt sich nur mit einem
Astroprogramm (mit entsprechnenden Grundkenntnissen) durchführen.
|
|
|
|
|
8.
|
|
Bezeichnungen wie "angeflanscht"
und "Stabilitätsprobleme bei
der Navigation" entlarven Gernot Geise als technisch
unbedarften Laien.
Formulierungen wie "merkwürdigerweise anscheinend
überhaupt nicht" sind geradezu literaturnobelpreisverdächtig ...
|
|
|
|
|
9.
|
|
Alle wichtigen LM-Modifikationen ab Apollo15: Apollo Summary
Tabelle4-V PDF
S.250/251
|
|
|
|
|
10.
|
|
|
|
|
|
|
|













